Im letzten Jahrzehnt hat sich ESG von einem Nischenthema zu einer strategischen Säule für viele Industrieunternehmen entwickelt. Heute wird das ESG-Rahmenwerk jedoch zunehmend mit kulturellen Debatten und politischen Agenden verknüpft. In vielen Regionen, insbesondere in den USA, ist der einst klare Fokus auf nachhaltige ökologische Ergebnisse aufgeweicht. Dies führt zu der Wahrnehmung, dass es ESG-Strategien an greifbaren und messbaren Resultaten mangelt.
„ESG ist tot.“ Auch wenn dies eine Übertreibung sein mag, wandelt sich die Rolle von ESG unbestreitbar. Im Industriesektor betrachten Führungskräfte ESG nicht länger als das vorherrschende Leitnarrativ. Stattdessen prüfen sie kritisch dessen praktische Auswirkungen auf das Wachstum und die Widerstands- sowie Wettbewerbsfähigkeit.
Larry Fink, CEO von BlackRock, fasste dieses Dilemma prägnant zusammen: „Stakeholder-Kapitalismus ist nicht ‚woke‘. Es ist Kapitalismus, der von für alle Seiten vorteilhaften Beziehungen angetrieben wird.“ Trotz der Bemühungen, ESG als eine wertebasierte Geschäftspraxis neu zu positionieren, ist der Begriff in den USA stark politisiert worden. In Europa hingegen hält die Dynamik an, wird aber zunehmend durch komplexe regulatorische Rahmenbedingungen gebremst.
Allein unter der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) werden über 50.000 Unternehmen neuen ESG-Offenlegungspflichten unterliegen. Viele davon sind mittelständische Unternehmen, die zum ersten Mal berichtspflichtig werden.
Wie die WirtschaftsWoche kürzlich feststellte, ist der Effekt bereits sichtbar: Führungskräfte verlagern Zeit und Ressourcen von der Transformation zum Ausfüllen von Formularen. Hinter verschlossenen Türen hinterfragt eine wachsende Zahl von Managern, ob ihr Nachhaltigkeitsnarrativ noch mit der operativen Realität übereinstimmt – oder ob es einer pragmatischen Überarbeitung bedarf.
Unterdessen vertieft sich die politische Kluft zwischen den USA und der Europäischen Union. Denn die EU verfolgt vor allem einen fragmentierten ESG-Ansatz. Die USA lenken im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) dagegen über 369 Milliarden USD in saubere Energien – einschließlich einer Subventionierung von bis zu 3 USD pro kg Wasserstoff, die an das Erreichen von Emissionsreduktionen geknüpft ist. Dies geschieht unabhängig von der Produktionsmethode.
| Politische Gegensätze führen zu unterschiedlichen strategischen Ergebnissen | |
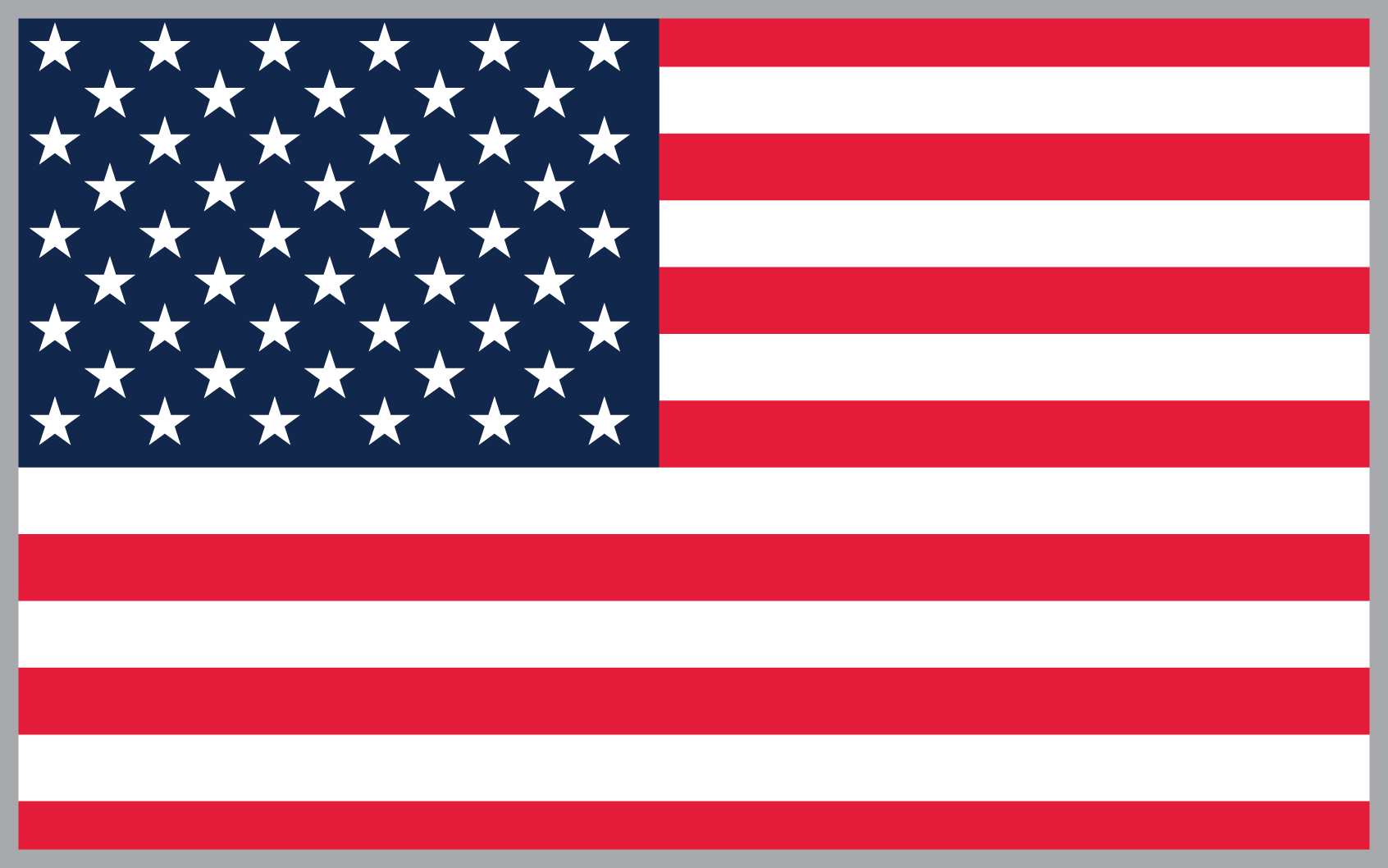 | 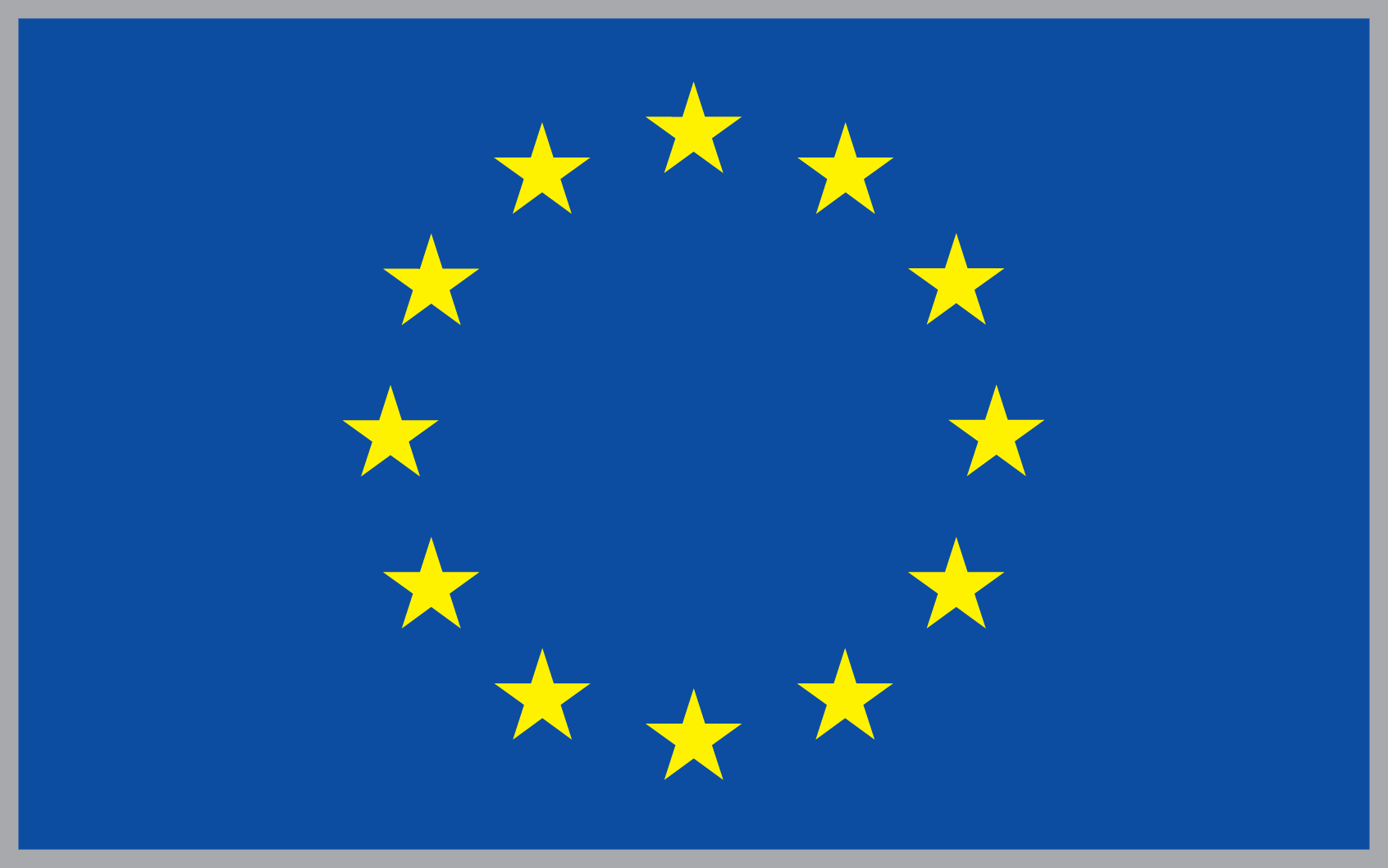 |
US-Ansatz (Inflation Reduction Act | EU-Ansatz (z. B. Green Deal, CSRD |
369 Mrd. USD Fördermittel für saubere Energien | Über 50.000 Unternehmen von der CSRD betroffen |
3 USD/kg H₂-Subvention, unabhängig von der Produktionsmethod | Komplexe Genehmigungsverfahren, fragmentierte Subventionen |
| Hohe M&A-Dynamik im Green-Tech-Sekto | Hohe Berichtslast, Risiko der „Transformationsmüdigkeit“ |
| Fazit: „Man bekommt Dollar“ | Fazit: „Man bekommt Formulare“ |
Investitionsreaktionen spiegeln die strategische Neuausrichtung wider
Diese Divergenz ist nicht länger nur theoretisch. Laut einer Umfrage von BCG und dem Verband der Chemischen Industrie (VCI) aus dem Jahr 2024 bevorzugen über zwei Drittel der deutschen Chemieunternehmen inzwischen Investitionen außerhalb Deutschlands. Als Gründe nennen sie Energiepreise, Planungsunsicherheit und regulatorische Belastungen. Die Inlandsinvestitionen in der Branche sanken 2023 um mehr als 40 %, während Unternehmen wie BASF 660 Millionen Euro in neue Produktionskapazitäten in China investierten. Bevorzugte Ziele sind die USA, wo die Anreize des IRA günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen schaffen, sowie Schwellenländer im Nahen Osten und in Asien.
Ähnliche Spannungen zeigen sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Chemie-, Energie- und der Materialienindustrie. Im Energiesektor positionieren sich die globalen Konzerne von Grund neu. BP hat kürzlich seine Emissionsziele für 2030 zurückgenommen und dies mit dem Druck der Investoren und der Notwendigkeit begründet, Dekarbonisierung und Profitabilität in Einklang zu bringen.
Energieversorger wie Vattenfall und E.ON haben aufgrund steigender Kosten und unklarer regulatorischer Rahmenbedingungen größere Investitionen in erneuerbare Energien verschoben. In Frankreich setzt EDF unterdessen verstärkt auf Kernkraft – was die uneinheitliche Energielandschaft der EU noch weiter verstärkt.
Im Bereich der Chemie und Werkstoffe lassen hohe Scope-1-Emissionen und die geringe Sichtbarkeit von „Green Premiums“ (Aufpreisen für nachhaltige Produkte) den Herstellern von Basischemikalien ohne politische Klarheit kaum Anreize, die Dekarbonisierung voranzutreiben. Stahl- und
Aluminiumunternehmen wie ArcelorMittal und Norsk Hydro haben mit stark gestiegenen Energiekosten und dem Risiko des „Carbon Leakage“ (Abwanderung von CO₂-intensiven Industrien) zu kämpfen. Ihre Fähigkeit, Investitionsrisiken (CAPEX) zu minimieren, hängt oft vom Zugang zu grünem Strom ab. Für Baustoffproduzenten, wie in der Zementindustrie, ist die Emissionsintensität tief strukturell verankert. Für sie ist ESG nicht nur eine Marken- oder Preisfrage, sondern eine langfristige „License to operate“ (Existenzberechtigung).
Strategische Prioritäten für das Wachstum in der Industrie
Während geopolitische Spannungen und Nachhaltigkeitsauflagen die globalen Märkte neugestalten, müssen Führungskräfte in der Industrie ihre Wachstumsagenda grundlegend überdenken. Die Schlüsselfrage ist nicht mehr, ob ESG noch relevant ist, sondern wie sich strukturelle Umbrüche in nachhaltiges und profitables Wachstum umwandeln lassen. Hier sind drei strategische Prioritäten für Unternehmen aus den Bereichen Chemie, Energie und Werkstoffen:
1. Wachstumsstrategien in der neuen Energiewirtschaft definieren
Unternehmen bewerten neu, wie und wo sie in aufstrebende Wachstumsfelder investieren sollen – von Wasserstoff und biobasierten Chemikalien bis hin zu kohlenstoffarmen Materialien und Kreislaufwirtschaftsmodellen. Dies ist besonders dringlich für Energieversorger, Hersteller von Basischemikalien und Metallproduzenten, die bei der Budgetallokation zwischen Dekarbonisierung und Wettbewerbsfähigkeit abwägen müssen.
Zu berücksichtigende Schlüsselfaktoren sind vor allem:
- Bereiche, in denen Nachhaltigkeitsinvestitionen nicht nur Compliance, sondern auch Wachstums- und Margenpotenzial liefern.
- Technologien und Regionen, die für eine Skalierung am besten positioniert sind.
- Schritte, um Unternehmen als Marktgestalter und nicht als Nachzügler zu positionieren.
2. Nachhaltigkeit in einen wirtschaftlichen Vorteil verwandeln
Die Kunden von heute erwarten umweltfreundliche Produkte, stellen aber oft Aufpreise für Umweltfreundlichkeit in Frage. Unternehmen müssen ESG-Kriterien daher in einen wirtschaftlichen Mehrwert übersetzen. Dies gilt branchenweit, ist aber besonders akut bei nachgelagerten Werkstoffen oder Verpackungen, wo der Preisdruck hoch ist und Einkäufer mit hohen Spezifikationsanforderungen dominieren.
Zu berücksichtigende Schlüsselfaktoren sind vor allem:
- Nachhaltigkeit zu einem glaubwürdigen Bestandteil des Kundenversprechens zu machen.
- Vertriebs-, Preis- und Angebotsstrukturen zu identifizieren, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Ziele unterstützen.
- Wege zur Differenzierung in „grünen“ Märkten zu finden, bevor die Margen durch die Kommodifizierung erodieren.
3. Wert durch strategische Transaktionen schaffen
Da Regulierung, CO₂-Risiken und Standortdruck die Werttreiber neu definieren, spielt Nachhaltigkeit eine wachsende Rolle bei M&A- und Investitionsentscheidungen. Die „Brown-to-Green“-Transformation (die Neuausrichtung von konventionellen zu nachhaltigen Anlagen) ist besonders relevant in anlagenintensiven Sektoren wie Zement, Raffinerien und Industrieparks, wo die Bewertung zunehmend von der zukünftigen CO₂-Resilienz abhängt.
Zu berücksichtigende Schlüsselfaktoren:
- Auswirkungen von Rahmenwerken wie dem IRA oder dem Green Deal auf Bewertungen, Transaktionsaktivitäten und zukünftige Renditen.
- Glaubwürdigkeit von „Brown-to-Green“-Transformationsstrategien in der Unternehmensprüfung & -bewertung sowie der Value Creation.
- Weiterentwicklung der Due Diligence, um die Zukunftsfähigkeit der Vermögenswerte widerzuspiegeln (und nicht nur die vergangene Leistung).
Vom Pflichtprogramm zum Wettbewerbsvorteil: Wie Simon-Kucher helfen kann
Wie wird das Nachhaltigkeitsnarrativ von morgen pragmatisch definiert? Die Antwort darauf, entscheidet darüber, welche Unternehmen gestärkt aus dem kommenden Umbruch hervorgehen und welche Schwierigkeiten haben werden, sich anzupassen.
Unsere kommende „Chemicals, Energy & Materials (CEM) Study 2025“ wird darüber hinaus quantifizieren, auf welche Weise Führungskräfte in Nordamerika und Europa in einer Zeit des politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Wandels Wachstumsimpulse priorisieren.
Wir bei Simon-Kucher sind davon überzeugt, dass jetzt die Zeit für pragmatische, wachstumsorientierte Nachhaltigkeitsstrategien ist. Auch die Perspektive Ihres Unternehmens ist entscheidend, um die CEM-Studie zu gestalten und sicherzustellen, dass sie die realen Herausforderungen und Prioritäten des Industriesektors widerspiegelt. Wo haben sich Ihre Nachhaltigkeitsbemühungen ausgezahlt oder sind ins Stocken geraten? Welche regulatorischen oder politischen Veränderungen sind für Ihr Unternehmen am relevantesten? Wo sehen Sie neue Chancen, die sich aus den Marktverwerfungen ergeben?
Kontaktieren Sie gerne unsere Experten, um dieses Gespräch fortzusetzen.
In unserem nächsten Artikel werden wir untersuchen, wie Energiepreise, Standortökonomie und Subventionsrahmen wie der IRA und der Green Deal die Investitionsentscheidungen von Unternehmen beeinflussen. Bleiben Sie dran für den zweiten Teil unserer Serie zu den Entwicklungen für Chemicals, Energy & Materials und kontaktieren Sie uns gerne, um einen frühzeitigen Zugang zu unserer neuesten Studie zu erhalten.
Unsere kommende „Chemicals, Energy & Materials Study 2025“ wird sich noch eingehender damit befassen, wie führende Industrieunternehmen in Nordamerika und Europa den strukturellen Wandel bewältigen und welche Kommerzialisierungsstrategien sich als die effektivsten erweisen werden.
Form placeholder. This will only show within the editor







